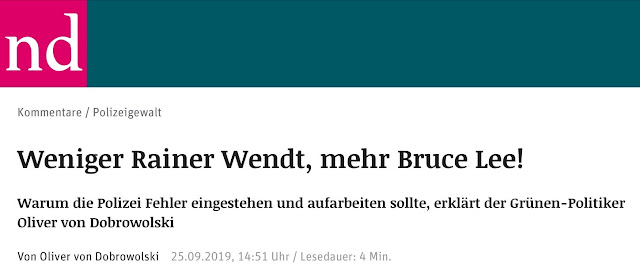1. Vorsitzender Oliver von Dobrowolski eine Kolumne zur Fehlerkultur bei der Polizei verfasst. Sie kann
hier online abgerufen werden.in denen bereits ein einziger Fehler häufig zu irreparablen Schäden führen kann.
Defizite Grund für eine möglicherweise schlechte Fehlerkultur?
Vertreter der Polizei, meist über Lobbyverbände (Gewerkschaften), aber auch Zivilgesellschaft und Gruppen mit besonders scharfem Blick auf die Gesetzeshüter. Es verwundert nicht, dass man zu durchaus unterschiedlichen Ergebnissen kommt.
nach Gehaltsanpassungen und besserer Ausstattung. Andererseits machen diese Vereinigungen auch Tagespolitik und äußern sich zu Themen der inneren Sicherheit. Hier beklagen sie Evergreens wie mutmaßlich mangelnden Respekt vor der Polizei, zu geringe Strafen oder – in den vergangenen Jahren extrem gern genommen – einen angeblichen Generalverdacht gegen die rund 250.000 Polizist*innen in Deutschland, wenn die Einführung rechtsstaatlicher Kontrollmechanismen wie zum Beispiel die Kennzeichnungspflicht oder externe Beschwerdestellen gefordert wird.
folgt wohl zuallererst der typischen Beamtenregel »Das haben wir schon immer so gemacht«. Nicht zeitgemäß, aber der olle Spruch indiziert, dass auch heute noch viele Verlautbarungen der Polizei reflexhaft auf Abwehr getrimmt sind. Getreu dem Motto, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Vielleicht ist hierdurch sogar taktisch beabsichtigt,
das Vertrauen in die Polizei nicht zu erschüttern, indem man das Bild einer fehlerlosen Institution aufrechterhält. Immerhin greifen Polizeikräfte täglich in Grundrechte der Bürger*innen ein, was nicht wirklich jedem Betroffenen gefällt. Doch liegt hier der fatale Irrtum: Vertrauen leidet und schwindet, wenn man trotz eindeutiger Gegenbeweise – heute auch durch die Allgegenwart smarter Geräte auf unseren Straßen – betonkopfartig Fehlverhalten abstreitet.
Lee immerhin ein anderer Held heranziehen, der gesagt hat: »Fehler sind immer zu verzeihen, wenn man den Mut hat, diese auch zuzugeben.«
der Stadt und heutige Bundesfinanzminister Olaf Scholz, bei dem viel Stadtsubstanz und Vertrauen zu Bruch ging. So argumentiert man oft bei den vielen Enthüllungen zur rechter Gesinnung einiger Polizist*innen, zu ersten Polizeigewalt-Forschungsergebnissen der Gruppe um Tobias Singelnstein – und leider zuletzt auch anlässlich der Kritik zum rustikalen Einsatz der Hamburger Polizei gegen Demonstrierende bei »Fridays for Future«. Vielen ging hier der Hut hoch. Die Polizei hat doch gewalttätig auf friedliche junge Menschen eingewirkt, so die Ansicht einiger Beobachter.
Polizei weiter im Fokus steht. Dass gute Arbeit gelobt und Fehlverhalten benannt wird. Weniger Rainer Wendt, mehr Bruce Lee!